| Im Folgenden dokumentieren wir einen Artikel aus der Bahamas zur aktuellen Diskussion um Homophobie in der Reggae-/Dancehall-Szene Jamaikas und der internationalen Rezeption |
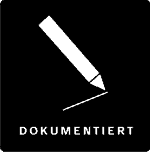
Marihuana des Volkes |
Homophobie und Volksmusik auf JamaikaAls Mitte des Jahres 2004 eine Deutschland-Tournee des jamaikanischen Dancehall-Reggae-Stars Buju Banton wegen schwul-lesbischer Proteste abgesetzt werden mußte, geisterte für kurze Augenblicke ein Thema durch die Öffentlichkeit, über das ansonsten interessiert geschwiegen wird: Homophobie auf Jamaika. Anstatt sich jedoch die Frage zu stellen, warum ein extrem homophober Musiker wie Buju Banton nicht nur auf Jamaika ein Superstar werden kann, wurde die Sache als skandalöser Einzelfall abgetan. Die antikoloniale Nachsicht, die der Inselstaat und seine Folklore spätestens seit Bob Marleys großen Erfolgen erfährt, trägt erheblich zu dieser Verharmlosung bei. Der kritiklosen Atmosphäre auf
zahllosen Reggae-Parties stand der Skandal um Buju Banton erst recht nicht im
Weg. Es ist schon eigenartig, daß sich das frauenverachtende und
homophobe Symbol der Rastafaris, die Dreadlocks, großer Beliebtheit
gerade unter jenen erfreuen, die den antipatriarchalen und antisexistischen
Kampf als festen Bestandteil ihrer widerständigen Identitiät
begreifen.
erheblich zu dieser Verharmlosung bei. Der kritiklosen Atmosphäre auf
zahllosen Reggae-Parties stand der Skandal um Buju Banton erst recht nicht im
Weg. Es ist schon eigenartig, daß sich das frauenverachtende und
homophobe Symbol der Rastafaris, die Dreadlocks, großer Beliebtheit
gerade unter jenen erfreuen, die den antipatriarchalen und antisexistischen
Kampf als festen Bestandteil ihrer widerständigen Identitiät
begreifen. Sommer, Sonne, Friedfertigkeit? „If you’re gay in Jamaica, you’re dead“, so lautete die Überschrift eines am 02.08.2004 im britischen Guardian erschienen Artikels von Diane Taylor, die im Gegensatz zu den endlos reproduzierten Klischees über Jamaika als dem Land für Hanf und Dampf keine Fiktion beschreibt. Wenn überhaupt zur Kenntnis genommen wird, daß der jamaikanische Lebensalltag alles andere als romantisch ist, so wird dies nicht nur in Deutschland meist als Beweis für die Authentizität der Insel-Folklore angesehen. Als wäre die einzigartig hohe Kriminalitäts- und Mordrate nichts als ein Geburtshelfer „echter“ Kultur, werden auch die sogenannten Ghettos in Kingston, Spanish Town oder Montego Bay nicht als Wiege des Elends wahrgenommen, sondern als Stätten des die Kreativität befördernden Mangels und sogenannter Streetcredibility, durch die „echtes“, unverstelltes Leben „noch“ erfahrbar würde. Kein Wunder, daß bei soviel romantischer Verklärung nicht in den Blick gerät, worin sich fast alle Jamaikaner einig sind: Wie eine repräsentative Umfrage im Herbst 2003 ergab, sprechen sich 95 Prozent der Bevölkerung vehement gegen eine Aufhebung des gesetzlichen Verbotes homosexueller Beziehungen aus.(1) Vielleicht ist bei 95 Prozent der Jamaikaner die Message von „Love and Respect“, die jeder Europäer automatisch mit dem Stichwort Reggae in Verbindung bringt, nur noch nicht angekommen? Die archaische Gesetzeslage jedenfalls scheint dort niemanden ernsthaft zu stören. Nicht nur Analverkehr ist dort strengstens verboten (Artikel 76), schon der Versuch steht unter schwerer Strafe (Artikel 77). Ersterer wird mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 10 Jahren inklusive schwerer Zwangsarbeit geahndet, letzterer mit bis zu 7 Jahren Gefängnis. Doch damit nicht genug, jegliche körperliche Intimität zwischen Männern wird mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft – inklusive der Option schwerer Zwangsarbeit (Artikel 79). Bei einer solchen Gesetzes- und Stimmungslage ist es nur folgerichtig, wenn Jamaikas Präsident P. J. Patterson von der regierenden People’s National Party (PNP) erklärt, mit seiner Regierung werde es die von „Amnesty International vorangetriebene Legalisierung von Homosexualität“ nicht geben und diese Aussage im Jahre 2001 mit dem Ausschluß von Schwulen aus der Pfadfindervereinigung praktisch untermauerte. Keinen Deut besser ist der politische Gegner, die Jamaican Labour Party (JLP), die 2001 in ihrer Wahlkampagne mit dem auch international sehr erfolgreichen Song „Chi Chi Man“ der Gruppe T.O.K. warb. Im Refrain dieses Songs heißt es: „Wo immer du ein schwules Pärchen im Auto siehst, zünde es an; wo immer du ein schwules Pärchen in einer Schwulenbar einen Drink nehmen siehst, zünde es an.“ (2) Angesichts solcher Zustände kommt selbst die Organisation Human Rights Watch (HRW), die sonst immer viel Nachsicht für kulturelle Eigenarten postkolonialer Völker zeigt, nicht umhin, die Dinge unmißverständlich beim Namen zu nennen. In dem Bericht „Hated to death: Homophobia, Violence and Jamaica’s HIV/AIDS Epidemic“ aus dem Jahr 2004 heißt es: „Abuses against men who have sex with men take place in a climate of impunity fostered by Jamaica’s sodomy laws and are promoted at the highest levels of government.“ (3) Die jamaikanische Polizei, deren Brutalität zum Alltag gehört, begnügt sich nicht mit der Durchsetzung der Gesetze, sondern verdankt der homophoben Grundstimmung eine an Willkür grenzende Handlungsfreiheit gegenüber Homosexuellen. Allein der Verdacht, ein Mensch sei homosexuell, genügt ihr, ihn oder sie zu beleidigen, zu verfolgen, zu erpressen, zu inhaftieren oder auch zusammenzuschlagen. Im HRW-Bericht heißt es: „Police abuse is a fact of life for many men who have sex with men and women who have sex with women.“ Die meisten Überfälle auf Homosexuelle werden deshalb erst gar nicht der Polizei gemeldet. Ein Betroffener schildert es so: „I went to the police to report [...] threats. They wouldn’t come. They said that we don’t have a right to live in our own country and that they would chop us up and kill us.“ (4) Es gibt Fälle, in denen Polizei-Übergriffe auf Schwule andere Anwesende zu spontanen Attacken animieren. Auch über einen solchen Vorfall berichtet HRW: Nachdem Victor vorgeworfen wurde, er sei schwul, verprügelten ihn am 18.6.2004 zwei Polizisten, die zufällig in der Nähe waren. Mit den Worten „Beat him because him a battyman“, stachelten sie sich gegenseitig an („battyman“ steht ebenso wie „chi chi man“ abfällig für einen Schwulen). Die Leute am Ort des Geschehens begannen daraufhin nach dem Vorbild der Polizisten ebenfalls auf Victor loszugehen und warfen Steine und Flaschen nach ihm. Als sich immer mehr Menschen anschlossen und auf das Opfer einschlugen, verließen die Polizisten den Tatort und überließen dem Mob das Feld. Am nächsten Morgen wurde Victor tot am Strand aufgefunden. Bei anderen Fällen berichtet Human Rights Watch über absichtliche Nachlässigkeit bei der Aufklärung von Morden an Schwulen oder Lesben. Am 9.6.2004 wurde der prominenteste Kämpfer für die Rechte von Homosexuellen, der Vorsitzende der illegal arbeitenden schwullesbischen Organisation J-Flag, Brian Williamson, durch zahlreiche Messerstiche ermordet in seinem Haus aufgefunden. Nachdem die Spurensicherung der Polizei beendet war und sie den Tatort verlassen hatte, wurde ein Freund fündig. Nahe der Stelle, an der Williamsons Leiche gefunden wurde, fand er ein Messer und einen Eispickel, an denen Blut klebte. Ein Zeuge, der zwei Verdächtige vom Haus des Ermordeten wegrennen gesehen hatte, wurde auf Grund des Fundes zu einer Gegenüberstellung gebeten, aber schon auf dem Weg zur Polizeistation wurde er angepöbelt, weil er die Täter identifizieren wollte. Nach Darstellung der Polizei war die Ermordung Williamsons frei von jedem schwulenfeindlichen Hintergrund und wurde deshalb ausschließlich als Raubmord deklariert. Schon der Umstand, dass Williamson wegen seines Engagements ein Hassobjekt darstellte, legitimiert erhebliche Zweifel an Richtung und Intensität der polizeilichen Ermittlungen. Umso mehr, als Williamson noch im Mai 2004 über die Zustände auf Jamaika urteilte: „Wir Schwule gelten hier als Kinder des Teufels und werden auf die andere Straßenseite verbannt oder von unseren Mitbürgern zu Tode geprügelt.“ (5) Es war alles andere als ein Zufall, daß sich nach Bekanntwerden von Williamsons Ermordung spontan ein Mob auf der Straße versammelte und seinen Tod mit Rufen wie „Let’s kill all of them“ bejubelte. (6) Doch nicht nur Schwulenfeindlichkeit gehört zum Alltag, auch Lesben oder Frauen, die als solche gelten, haben auf Jamaika nichts zu lachen. Vergewaltigungen, die als „Bekehrungen“ angesehen werden, kommen nicht selten vor, und auch in diesen Fällen verhält sich die Polizei gegen die Täter wohlwollend und abfällig gegen die Opfer. Neue Nahrung erfuhr die traditionelle Homophobie auf Jamaika, seitdem die Angst vor Aids grassiert. 1,5 Prozent der erwachsenen Bevölkerung sind mittlerweile infiziert und viele auf Jamaika glauben, daß es sich um eine spezielle Krankheit von Homosexuellen handelt, die auf die „moralische Unreinheit“ von Schwulen und Lesben zurückzuführen sei. Fatal an dieser aggressiven Verschwörungstheorie ist nicht nur ihre weite Verbreitung auf Jamaika, sondern die damit einhergehende falsche Bekämpfung von Aids, oder besser: Nichtbekämpfung. Im HRW-Bericht heißt es dazu: „Pervasive and virulent homophobia, coupled with fear of the disease, impedes access to HIV prevention information, condoms, and health care.“ Eine besondere Rolle nicht nur bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien über Aids kommt der Kirche zu. Mit ihrem großen Einfluß reproduziert sie immerfort die ohnehin durchgesetzte Sichtweise, daß Homosexualität unnatürlich und eine Sünde sei. Es gibt kaum einen Priester, der nicht mit Verweis auf die Bibel gegen Schwule und Lesben predigen würde. Aus dem Munde des bekannten Musikers Elephant Man klingt die heilige Botschaft so: „We (Jamaicans) know that this thing (homosexuality) is not right and we are not going to uphold it. The Jamaican heritage is deep, we love God and we are not involved in certain things. From the time I was growing up, I learned that chi chi man fi get bun (was in etwa so viel bedeutet wie: have to get burned)“ (7) Daß eine solche Frömmigkeit nicht dazu beiträgt, die traditionell engen Familienbande in Frage zu stellen, ergibt sich unter diesen  >
Bedingungen wie von selbst. Es sind nicht nur die ärmlichen
Verhältnisse, die zur Elendsselbstverwaltung zwingen, die Mixtur aus
Religion und Familie ist auf Jamaika im Marxschen Sinne so etwas wie das
Marihuana des Volkes. Der Anpassungsdruck, den die Familie von Geburt an auf
den Einzelnen ausübt, läßt sich auf den für
zeitgenössische westliche Gesellschaften äußerst
fragwürdigen Begriff Zwangsheterosexualität bringen: als
Unterdrückung mit dem Ziel, eine gesellschaftliche Konformität
durchzusetzen, wie sie in durchschnittlichen westlichen Familien kaum mehr
anzutreffen ist. >
Bedingungen wie von selbst. Es sind nicht nur die ärmlichen
Verhältnisse, die zur Elendsselbstverwaltung zwingen, die Mixtur aus
Religion und Familie ist auf Jamaika im Marxschen Sinne so etwas wie das
Marihuana des Volkes. Der Anpassungsdruck, den die Familie von Geburt an auf
den Einzelnen ausübt, läßt sich auf den für
zeitgenössische westliche Gesellschaften äußerst
fragwürdigen Begriff Zwangsheterosexualität bringen: als
Unterdrückung mit dem Ziel, eine gesellschaftliche Konformität
durchzusetzen, wie sie in durchschnittlichen westlichen Familien kaum mehr
anzutreffen ist.„Rasta no mix up with homo“(8) Der Volksmusik-Charakter des Reggae in all seinen Spielarten, insbesondere die seit den 80ern besonders populäre Dancehall, ergibt sich nicht zuletzt aus dem Umstand, daß er dem gesunden Volksempfinden Ausdruck verleiht. Deswegen ist die Homophobie auch keine zu vernachlässigende Randglosse im Reggae, sondern zentral und konstitutiv. Über die sogenannten Batty Tunes, also die Lieder mit explizit homophobem Inhalt hinaus ist die Abneigung gegen Homosexualität eine Grundstimmung, die den gesamten Habitus des Reggae bestimmt. Nachvollziehbar wird das durch seine Vorgeschichte: Der Reggae hat sich erst Ende der 60er Jahre aus dem stark am amerikanischen Rythm’n’ Blues und Soul orientierten Rocksteady und Ska entwickelt, deren latente Homophobie jedoch keine originär jamaikanische Angelegenheit war, sondern aus der Imitation urbaner amerikanischer Lebensart resultierte, deren Gangster- und Machogehabe weit verbreitet war. Für den Reggae dagegen, der sich gerade in Abkehr von der Idealisierung westlicher Lebensvorstellungen entwickelte, und stattdessen eine Hinwendung zur Religiösität verkörpert, ist Homosexualität nicht nur eine Ausgeburt des Westens, sondern schlechthin eine der weißen Rasse. Der Rastafarianismus, der die schwarze Rasse aufgrund ihrer Sklaven- und Kolonialgeschichte zum auserwählten Teil der Menschheit erklärt, ist die geistige Brutstätte des Reggae. In dieser Pseudo-Religion ist „Babylon“ das Böse, „Zion“ das gelobte „Motherland Afrika“ und „Jah“ der Erlöser, personifiziert in Ras Tafari Makonnen Haile Selassie, der in der Mitte des vorigen Jahrhunderts gekrönte schwarze äthiopische Kaiser. Der von Grund auf rassistische Gehalt des Rastafari-Glaubens stellte nicht etwa ein Hindernis für die weltweite Popularisierung des Reggae dar, im Gegenteil, er ist bis heute die Grundlage seines Erfolges im Westen. Als antikoloniale und antirassistische Ideologie verklärt, wird ihm quer durch alle gesellschaftlichen Lager Absolution erteilt. Wie kein zweiter Reggae-Song ist Bob Marleys „Exodus“ ein einziges Plädoyer für schwarzen Rassismus. Exodus, „movement of Jah People“, wie es weiter heißt, steht für die „Rückkehr“ zu den Wurzeln („Roots“) aller Schwarzen aus dem verruchten Westen („Babylon“) nach Afrika. Es ist bezeichnend, daß Marleys Popularität erst ab dem Zeitpunkt enorm zunahm, als er sich 1970 öffentlich als Rastafarian bekannte; zu einem Zeitpunkt, als der Reggae zum jamaikanischen Exportschlager wurde wie Marihuana. Die Propagierung eines asketischen Lebens ohne sündhafte Vergehen, ohne Lustgewinn und materiellen Reichtum ist bei den Rastas der schwarze Gegenentwurf zum weißen Westen. Daß Homosexualität verteufelt werden muß, ist daraus eine fast notwendige Folge, zumal ihre strikte Ablehnung zugleich der Freibrief für den natürlich auch dort regelmäßigen „Verstoß“ gegen Askese ist. Mit Bezugnahme auf die Bibel, die bei ihnen einem Gesetzbuch gleichkommt, hängen Rastas einem religiösen Bild der Liebe und Partnerschaft an, das Homosexualität für unnatürlich erklärt. „God created Adam and Eve, not Adam and Steve“, so eine beliebte Floskel. Mit Bibelzitaten (z.B. Der Brief des Paulus an die Römer, 1. Kapitel, 26) werden solche Sichtweisen „belegt“. Auf andere „Beweise“ für die Widernatürlichkeit von Homosexualität legt man erst gar keinen Wert: „Die Realität bleibt die Realität, Prophezeiungen sind Prophezeiungen (...). Zwei Millionen Rastas können nicht durch Frankreich gehen, aber zwei Millionen Schwule können es. Das ist Babylon! Wenn nur 100 Rastas auf die Strasse gehen, werden sie verprügelt. Die Schwulen gehen ungehindert (...). Der jamaikanische Lebensstandard ist nicht jamaikanisch. Alles wird durch Europa beeinflusst. Jamaika, Trinidad etc. sind alles Kolonien von Europa. Die Einflüsse Europas sind dort. Das europäische System ist dort.“ So bringt der gern auf europäischen Reggaeparties gespielte Anthony B die Rasta-Verschwörungstheorie auf den Punkt. (9) Rasta-Diaspora Das antiwestliche Ressentiment wird mit den „besten“ antikapitalistischen Argumenten angereichert. Eine solche Mischung läßt nicht nur so manches antirassistische Herz höher schlagen, sie macht den Haß auf Homosexuelle zu einer vernachlässigbaren Größe, zu etwas, das gar nicht so gemeint sein könne, wie es gesagt wurde, sondern wohl als Kollateralschaden antiimperialistischen Widerstands durchgehen muß. Daß so mancher Rasta-Ideologe Homosexualität eine „Krankheit der Weißen“ nennt, die erst durch Kolonisation eingeschleppt worden sei wie die westliche Kultur überhaupt, um die Schwarzen unterwürfig zu machen; solche und ähnliche Einsichten lassen keinen anderen Schluß zu, als Rastafarianismus rassistisch und homophob zu nennen. Deutsche Reggaefans verschwenden daran keinen Gedanken. Auf einer ihrer Internetseiten kann man stattdessen folgendes lesen: „Nicht mehr die Juden gelten als das wahre Israel, sondern die Rastafarians sind die Auserwählten, die auf dem Berge Zion leben werden. Doch was sie mit den Juden gemeinsam haben, ist die Exilsituation: Zerstreuung und Verfolgung. Diese doppelte Erfahrung ist für die Rastafari-Existenz letztendlich konstitutiv“ (10) Nicht nur, daß die Jahrtausende währende Verfolgung der Juden der wenige Jahrhunderte alten Kolonialgeschichte gleichgestellt wird, in der Vorstellung deutscher Reggaefans gelten Juden offensichtlich nur als Exilanten, die, wie die Schwarzen auch, nur solange ein Gastrecht in Anspruch nehmen würden, bis sie dort wieder Wurzeln („Roots“) schlagen können, wo sie „eigentlich“ hingehören. Dieser kulturalistische Hokuspokus hat zur Folge, daß man in Reggaekreisen auch den beliebten Black-Power-Sprech vom „Black Holocaust“ gern übernimmt, der nichts anderes meint als die Unterstellung, „die Weißen“ hätten mittels Sklaverei den Versuch einer systematischen Vernichtung der Schwarzen unternommen. Letztendlich ist der Rastafarianismus eine Heimatboden-Ideologie, der die „Rückkehr“ zu den „eigentlichen“ Wurzeln propagiert. Die Warnung vor „Kulturimperialismus“ geht also keineswegs zufällig mit der Zurück-nach-Afrika-Forderung einher. Statt eine individualisierte Lebensweise als ersten notwendigen Schritt zur wirklichen Befreiung anzusehen, wird der Rasta-Glaube als Antwort auf den für unheilbar krank gehaltenen Westen begriffen. Wenn man sich den Kontrast vergegenwärtigt, der zwischen einem Jamaika als No-Go-Area für Schwule und Lesben auf der einen und einem Westen auf der anderen Seite existiert, der Homosexualität mittlerweile mehrheitlich toleriert und gesetzlich schützt, dann wird überdeutlich, warum Rastas die Heilung des Geistes als Abgesang auf den Egoismus privaten Glücks predigen. Trotz der langen staatlichen Verfolgung ist die ausschließliche Opferperspektive der Rastafaris eine irrationale Angelegenheit, und das um so mehr, als der Rastafarianismus gerade durch den Reggae endgültig  gesellschaftsfähig wurde. Insbesondere wenn es gegen Homosexuelle geht,
wird aus dem ewigen Opfer die verfolgende Unschuld, die sich gegen die
Unterdrückung durch westliche Einflüsse („Babylon“) ihrer
Haut erwehren müsse. Richtig aber ist, daß der traditionelle
Rastafari selten zur Tat schreitet und stattdessen „Liebe“ als den
Weg zum Kampf gegen den babylonischen Westen predigt: „Rastafari werden
keine Waffe zur Hand nehmen und sich auch nicht mit dem Blut Babylons besudeln
müssen, denn Babylon wird sich selbst vernichten.“ (11)
gesellschaftsfähig wurde. Insbesondere wenn es gegen Homosexuelle geht,
wird aus dem ewigen Opfer die verfolgende Unschuld, die sich gegen die
Unterdrückung durch westliche Einflüsse („Babylon“) ihrer
Haut erwehren müsse. Richtig aber ist, daß der traditionelle
Rastafari selten zur Tat schreitet und stattdessen „Liebe“ als den
Weg zum Kampf gegen den babylonischen Westen predigt: „Rastafari werden
keine Waffe zur Hand nehmen und sich auch nicht mit dem Blut Babylons besudeln
müssen, denn Babylon wird sich selbst vernichten.“ (11)Homophobie als Obsession Trotz der extrem homophoben Grundstimmung auf Jamaika waren vor den 90er Jahren offene Aggressionen gegen Homosexuelle und entsprechende Song-Texte selten. Parallel zum Amtsantritt P. J. Pattersons, der seit 1992 Präsident ist, begann der Dancehall-Reggae zu boomen, der die öffentliche Hetze als akzeptierten Standard durchzusetzen half. Im Jahr von Pattersons Amtsantritt erschien eines der abscheulichsten Lieder von Buju Banton, der Song „Boom Bye Bye“. In ihm heißt es: „Schieß einen Schwulen in den Kopf/ richtige Jungs unterstützen keine Schwulen/ Sie müssen sterben/ besorg dir lieber ein automatisches Gewehr/ erschieß sie/ hilf ihnen nicht, wenn einer näher kommt/ schütten wir Säure über ihn/ verbrennen ihn/ wie einen alten Autoreifen.“ Auch wenn Stars wie Banton insbesondere außerhalb Jamaikas bei ihren Texten zurückhaltender geworden sind, so gibt es heute kaum einen Reggae-Sänger bzw. eine -Sängerin, der oder die nicht mindestens einen schwulenfeindlichen Song im Repertoire hätte. Selbst der Engländer David Rodigan, der vor über 25 Jahren den Reggae in Europa populär machte, kommt angesichts dieser Zustände nicht mehr umhin zu konstatieren: „Schwulenfeindliche Texte sind in jüngster Zeit schon fast zu einer Obsession in der Dancehall-Reggae-Kultur geworden.“ (12) Auch wenn der Rastafarianismus nicht mehr als handlungsanleitend gilt, gibt er nach wie vor den welterklärenden Hintergrund für die „Authentizität“ und „Echtheit“ des Dancehall-Reggae ab. „Jah“ und „Babylon“ spielen immer noch eine große Rolle als ausgewiesenes Glaubensbekenntnis. Themen wie Frauen und Sex, Waffen oder Geld sind daher nur vordergründig an amerikanischen Hip Hop angelehnt. Der Stellenwert der Homophobie ist hinsichtlich der öffentlichen Zurschaustellung von heterosexueller „Männlichkeit“ ein anderer: Der Homosexuelle, der als absoluter Gegensatz imaginiert wird, ist zugleich die absolute Bedrohung. Bounty Killer, einer der Shootingstars der letzten Jahre, dessen Musik auf keiner europäischen Dancehallparty fehlen darf, hat seinen Verfolgungswahn exemplarisch in dem Stück „Eagle and the Hawk“ verarbeitet: „Buhe die Schwulen aus/ Ich will sie nicht um mich herum haben/ Sie wollen mich tot sehen.“ (13) Bleibt die Frage zu klären, wie bei solch erdrückender Beweislast die nächste Reggae-Partie um die Ecke ungestört über die Bühne gehen kann, ohne daß automatisch ein Straftatbestand erfüllt wird. Ein Fall für einen Experten also. In diesem Fall heißt er Olaf Karnik und ist ein seit Jahren umtriebiger Missionar in Sachen jamaikanischer Volksmusik. Im Magazin Riddim, dem deutschen Fachblatt für Reggae, klärt Karnik auf: Weil alles nur eine Frage des Kontextes sei, müsse für den Reggae im allgemeinen und den Dancehall im besonderen festgestellt werden, daß Homophobie in Jamaika in erster Linie nichts anderes sei „als Entertainment“. (06/04) Andere Kulturrelativisten wie etwa der deutsche Tourveranstalter von Buju Banton, die Consense GmbH, setzen statt auf Analyse lieber gleich auf Dialog. Als der Lesben- und Schwulenverband Deutschlands die sofortige Absage der Banton-Tour forderte, konnte man bei der Konzertagentur nicht etwa Bantons abgrundtiefen Hass auf Homosexualität erkennen, sondern nur die „Hatz auf einen Künstler“ konstatieren, die eine „interkulturelle Auseinandersetzung“ verhindern würde. In der Reggaeszene nennt man Deutschland in Anlehnung an das verheißene Land Jamaika auch sehnsüchtig „Germaica“. Angesichts einer GmbH, die schon mit ihrem Namen „Consense“ ihre Kritiklosigkeit zur Schau trägt, ahnt man warum. Tim Münninghoff (Bahamas 46/2005) Fussnoten (1) www.br-online.de/jugend/zuendfunk/themen/gesellschaft/homophob.shtml (2) www.golyr.de/tok/songtext/386630_chi-chi-man.htm (3) www.hrw.org/reports/2004/jamaica1104/3.htm (4) www.hrw.org/reports/2004/jamaica1104/7.htm (5) zitiert nach: Klaus Jetz, Tödliche Hetze im Dancehall-Reggae, in: ila Nr. 278, September 2004 (6) www.outrage.org.uk/Tatchell-reggaesingers.asp (7) ebenda (8) aus dem Song „Praise ye Jah“ von Sizzla (9) www.wiseadvertise.ch/html/reggae/reggae_ background.htm (10) members.aol.com/riddimxl/rastafarianismus.htm (11) ebenda (12) wie Fussnote 1 (13) www.lyricsplanet.com/index.php3?style=lyrics&id=31522 |
|