| Im Folgenden dokumentieren wir ein Referat zur Ausstellung über das Frauen- und Mädchenkonzentrationslager Uckermarck „Ihr seid nicht vergessen!“. Die Aussstellung wurde organisiert vom Antifaschistischen Frauenblock Leipzig (AFBL). |
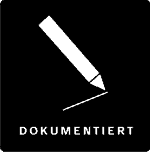
Keine wesentliche Unterbrechung? |
Die Ausgrenzung „Asozialer“ im Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit1. Einleitung  Georg Steigertahl, Direktor der hamburgischen Wohlfahrtsanstalten,
schrieb in seinen Erinnerungen: „Eines Tages wurde ich gegen Abend
von der Anstalt Farmsen(1) aus angerufen und um schnelle Hilfe
gebeten. Sechs Beamte mit dem Verwaltungsdirektor an der Spitze saßen als
Gefangene im Pfortenhaus; ein britischer Soldat stand vor ihrem
Behelfsverließ in strammer Haltung, welche er noch verbesserte, als ich
vor ihn trat. Mir bot sich im Anstaltsgehege ein seltsames Bild: Hunderte von
Frauen sahen gestikulierend aus ihren Stationsfenstern, etwa 50 junge Frauen in
rot-weiß-gestreifter Anstaltskleidung, folgten drei jungen Soldaten in
die Anlage, klagend jammernd, wirr ihre Freiheit fordernd. Als ich
selbstbewusst auf sie zuging, nahmen sie Vernunft an. Im Wachlokal erfuhr ich,
dass die Anstalt Farmsen ein KZ sei, in dem wie überall in KZs drakonische
Maßnahmen zur Tagesordnung gehörten. Meine Darlegungen, dass Farmsen
seit Jahrzehnten Bestandteil der Sozialbehörde sei, verfingen nicht. Was
bedeuteten in dem verruchten Deutschland schon Sozialbehörde,
Wohlfahrtsamt, Versorgungsheim? Als ich dann aber von Geschlechtskrankheiten zu
sprechen begann, trat ein Offizier auf mich zu, rief einen Dolmetscher heran
und suchte ein sachliches Gespräch. Jetzt begriff er sichtlich betroffen,
warum diese jungen Frauen über Polizei und Arzt hier eingewiesen worden
waren. Dem Spuk wurde bald ein schnelles Ende bereitet, kein Mädchen wurde
aus der Anstalt entlassen [...].“(2)
Georg Steigertahl, Direktor der hamburgischen Wohlfahrtsanstalten,
schrieb in seinen Erinnerungen: „Eines Tages wurde ich gegen Abend
von der Anstalt Farmsen(1) aus angerufen und um schnelle Hilfe
gebeten. Sechs Beamte mit dem Verwaltungsdirektor an der Spitze saßen als
Gefangene im Pfortenhaus; ein britischer Soldat stand vor ihrem
Behelfsverließ in strammer Haltung, welche er noch verbesserte, als ich
vor ihn trat. Mir bot sich im Anstaltsgehege ein seltsames Bild: Hunderte von
Frauen sahen gestikulierend aus ihren Stationsfenstern, etwa 50 junge Frauen in
rot-weiß-gestreifter Anstaltskleidung, folgten drei jungen Soldaten in
die Anlage, klagend jammernd, wirr ihre Freiheit fordernd. Als ich
selbstbewusst auf sie zuging, nahmen sie Vernunft an. Im Wachlokal erfuhr ich,
dass die Anstalt Farmsen ein KZ sei, in dem wie überall in KZs drakonische
Maßnahmen zur Tagesordnung gehörten. Meine Darlegungen, dass Farmsen
seit Jahrzehnten Bestandteil der Sozialbehörde sei, verfingen nicht. Was
bedeuteten in dem verruchten Deutschland schon Sozialbehörde,
Wohlfahrtsamt, Versorgungsheim? Als ich dann aber von Geschlechtskrankheiten zu
sprechen begann, trat ein Offizier auf mich zu, rief einen Dolmetscher heran
und suchte ein sachliches Gespräch. Jetzt begriff er sichtlich betroffen,
warum diese jungen Frauen über Polizei und Arzt hier eingewiesen worden
waren. Dem Spuk wurde bald ein schnelles Ende bereitet, kein Mädchen wurde
aus der Anstalt entlassen [...].“(2)Das Ende des nationalsozialistischen Regimes und der Befreiung der Konzentrationslager bedeutete für die von den Nazis als asozial Stigmatisierten und Verfolgten nicht unbedingt das Ende ihrer Ausgrenzung und Diskriminierung. Manchen gelang es in den Nachkriegswirren sich dem Zugriff der Behörden zu entziehen. Nicht wenige aber wurden weiterhin in den Anstalten und Arbeitshäusern interniert und waren darüber hinaus entmündigt und zwangssterilisiert. Viele von ihnen haben bis heute keine Entschädigung erhalten. Um die Kontinuitäten der Ausgrenzung dieser Gruppe von Verfolgten soll es im Folgenden gehen. 2. Von der Wohlfahrtspflege zur „Volkspflege“ Bereits in der Weimarer Republik war es üblich, die FürsorgeempfängerInnen in „sozial wertvolle“ und „minderwertige“ einzuteilen und ab 1924 wurden Sozialleistungen dieser Unterscheidung entsprechend gewährt.(3) Auch in der Jugendfürsorge wurde mit dem Noterlass von 1932 die Aussonderung der „Unerziehbaren“ gesetzlich angeordnet. Weitere Maßnahmen wie die sog. Asylierung, Bewahrung sowie die Sterilisation wurden vielerorts bereits praktiziert. Unter der Prämisse „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“ wurde die nationalsozialistische Wohlfahrts- und Sozialpolitik ab 1933 zur „Volkswohlfahrt“ umstrukturiert. Bereits ab Mitte der 20er Jahre hatte die Rassenhygiene als wissenschaftliche und soziale Bewegung Einzug und Akzeptanz in bedeutsamen Bereichen der öffentlichen Wohlfahrtspflege gefunden.(4) Das Grundanliegen der Rassenhygiene war die gezielte und „positive“ Beeinflussung und Kontrolle der Vererbungsanlagen innerhalb der gesamten Gesellschaft. Die Behauptung, dass sich Minderwertige in einem schnelleren Tempo vermehren würden als Höherwertige diente zur Legitimation einer qualitativen Bevölkerungspolitik. Vor allem bei der Suche nach Ursachen für Armut, soziale Mißstände oder soziale Unangepasstheit, diente das Modell der verborgenen Erbanlagen, die sich die entsprechende Umwelt suchen würde und umgekehrt als Erklärung. Mit diesem Instrumentarium konnten seelische, geistige und charakterliche Eigenschaften als versteckte Erbmasse bestimmten Gruppen zugeschrieben werden, ohne diese nachweisen zu müssen. Grundlegende Annahme war dass Verständnis von „Minderwertigkeit“ als erbliche Bedingtheit und damit als „Entartung“. Bevölkerungsgruppen, die von der Wohlfahrts und Fürsorgepolitik betroffen waren wie z.B. Fürsorgezöglinge, Obdachlose, Prostituierte, Bettler und Asoziale, galten als „Ballastexistenzen“, die auf Kosten der Fürsorge lebten. Gleichzeitig fand auf dem sozialen Sektor eine Professionalisierung in der Praxis sowie in der wissenschaftlichen Erforschung der unterschiedlichen Klientel der Fürsorge statt, die einen schnellen und systematischen Zugriff sowohl auf die Daten als auch auf die Menschen ermöglichte. Die Rassenhygiene und ihr Instrumentarium bot somit biologistische Lösungsalternativen zur Lösung der sozialen Frage: Kriminalität, soziale Abweichung, sexuelle Andersartigkeit, unheilbare Krankheiten und psychopathische Minderwertigkeit wurden als Degeneration des Erbguts interpretiert und schienen medizinisch lösbar. 3. Begriff „Asozial“ Die Bezeichnung „Asozial“ war keine Erfindung der Nazis, sie existierte vorher und ebenso nach dem Ende des NS-Regimes. Asozial ist eine von außen auferlegte negative Bezeichnung. Im Nationalsozialismus wurde auch synonym die Bezeichnung „gemeinschaftsfremd“ verwendet. Die Bezeichnung asozial beinhaltete keine klare Definition, sondern diente vielmehr als Sammelbegriff für alle diejenigen Personen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht in das Konzept der Volksgemeinschaft passten, dabei waren die Gründe für den Ausschluß sowohl rassistische Kriterien als auch soziale Unangepasstheit.(5) Nach dem Erlass zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung von 1937 galt als „asozial“, „...wer durch sein gemeinschaftswidriges, wenn auch nicht verbrecherisches Verhalten zeigt, dass er sich nicht in die Gemeinschaft einfügen .., sich der in einem nationalsozialistischen Staat selbstverständlichen Ordnung fügen will.“(6) Als Asoziale und damit Minderwertige galten z.B. kinderreiche Familien oder sogenannte „unordentliche“ Familien, die aus sozial schwachen Milieus kamen, Prostituierte, Nichtsesshafte bzw. Menschen ohne festen Wohnsitz, Homosexuelle, unterhaltssäumige Väter, SozialhilfeempfängerInnen, Alkoholabhängige sowie StraftäterInnen. Während bei Männern vorrangig Kriminalität, Straftaten oder das Versagen im Erwerbsleben als auffällig galten, spielte bei Frauen in erster Linie das Sexualverhalten, uneheliche Mutterschaft, „häufig-wechselnder-Geschlechtsverkehr“ – abgekürzt „hwG“, Prostitution und allein der Verdacht auf Abweichungen von der Sexualnorm die entscheidende Rolle für ihre Beurteilung.(7) Bei Mädchen und Frauen wurde Asozialität häufig mit ihrer sittlichen oder sexuellen Verwahrlosung begründet. Die Einstellung zur Lohnarbeit, der Wille sich unterzuordnen, Gehorsam waren Kriterien, deren Verstoß mit Haltlosigkeit und folglich dem Verdacht auf sexuelle Verwahrlosung einhergingen. Mädchen, die nicht dem Typus des sauberen, schlichten deutschen Mädels entsprachen oder Ehefrauen, die nicht die Rolle der deutschen Mutter einnehmen wollten, wurden als sogenannte Gefährdete betrachtet. Häufiges Wechseln des Arbeitsplatzes, ein lockerer Lebenswandel, der Besuch von Tanzveranstaltungen wurden immer mit der Gefahr des Abgleitens und der Prostitution konnotiert. Sexualität, die außerhalb von Ehe, Mutterschaft und Familie gelebt wurde, widersprach dem Aufbau der Volksgemeinschaft und musste deshalb auf schärfste geahndet werden. 4. Verfolgung von „Asozialen“ im Nationalsozialismus Die Verfolgung und Ermordung von Asozialen ist nicht nur aus rassenhygienischen Motiven heraus erklärbar, sondern basierte auch auf einer pragmatischen fürsorgerischen Ausgrenzung, wie sie bereits vor 1933 praktiziert wurde. Auch war die Verfolgung Asozialer weder einheitlich, noch basierte sie auf einer langfristigen Programmatik oder ließen sich einzelne Strippenzieher ausmachen. Vielmehr waren viele Akteure beteiligt: die Kommunen, die Fürsorge, Wohlfahrtsämter, Gesundheitsämter, Pflegeämter, Jugendämter und die Kriminalpolizei. Neu aber war im Nationalsozialismus das radikale Vorgehen gegen Asoziale. Es lassen sich zwei Phasen der Verfolgung ausmachen: In der ersten Etappe von 1933 bis 1938 waren es die Kommunen, die eigenständig mit Zwangsmaßnahmen, Schikanen und verstärkter Anstaltsunterbringung gegen missliebige FürsorgeempfängerInnen und gegen im Strassenbild sichtbare Asoziale wie z.B. Bettler, Landstreicher und Strassenprostituierte vorgingen.(8) Ab 1938 begann die zweite Phase der Verfolgung, die mit der umfassenden rassenhygienischen Erfassung, der Verhängung der Vorbeugungshaft, der Entwürfe für ein sogenanntes Gemeinschaftsfremdengesetz und der Einrichtung der Jugendschutzlager die radikale Vernichtung der „Asozialen“ anstrebte. Der Vorbeugehafterlass von 1937 bildet den Wendepunkt: Hiermit ging die Verfolgung und Ermordung von Asozialen in die Kompetenz der Polizei über und ging jetzt von oben, vom Reich aus. Ohne die Informationen und Zusammenarbeit mit den Fürsorgebehörden wäre die lückenlose Verfolgung jedoch nicht möglich gewesen. 1938 waren die Asozialen die größte Häftlingskategorie in den KZs. Im Verlauf der nationalsozialistischen Herrschaft wurde die Definition asozial und somit die Verfolgung und Vernichtung auf immer weitere Bevölkerungsgruppen ausgedehnt, vermischte sich auch mit politischen Anschuldigungen und wurde zunehmend in ungenügenden Arbeitsleistungen oder Verweigerung der Arbeitsverpflichtung als auch im sexuell unangepassten Verhalten junger Frauen gesehen(9). Mit Beginn des Krieges 1939 stieg die Besorgnis um eine zunehmende „Jugendverwahrlosung“ und insbesondere um die zunehmende sittliche Verwahrlosung der weiblichen Jugend. Das Reichssicherheitshauptamt warnte besonders vor dem „zunehmenden wahllos wechselndem Geschlechtsverkehr“ weiblicher Jugendlicher, der „erfahrungsgemäß zu den gefährlichsten Ansteckungsquellen für Geschlechtskrankheiten“ gehören würde(10). Infolgedessen wurde verschärfte Kontrollmaßnahmen eingeführt. Fürsorgerinnen und Beamtinnen der Weiblichen Kriminalpolizei sowie der BDM legten sich bei Kasernen auf die Lauer, führten in berüchtigten Lokalen oder anderen Vergnügungsorten, auf Rummelplätzen und Bahnhöfen Razzien durch, um gefährdete Mädchen und Frauen aufzuspüren. In den 40er Jahren stieg rapide die Zahl der sogenannten Arbeitsverweigerung als Einweisungsbegründung. Die Rüstungsproduktion benötigte dringend Arbeitskräfte, Mädchen und Frauen die sich der Arbeitsverpflichtung widersetzten, mussten auch mit Verfolgung rechnen. Die Erfassung und Disziplinierung von Mädchen und Frauen wurde mit dem Krieg zunehmend wichtig: • Zur Erhaltung der Volksgesundheit und damit der Wehrkraft • Zur Aufrechterhaltung der Sexualmoral an der Heimatfront • Und zum Erzwingen der Arbeitsdisziplin auch von Frauen. 5. Maßnahmen der nationalsozialistischen Verfolgung Bereits vor 1933 stand der Fürsorge ein weites Spektrum an Maßnahmen zur Ausgrenzung von „Asozialen“ zur Verfügung. Allerdings wurden nun mit dem Argument zum Schutz der Volksgemeinschaft die letzten Rechtsgarantien beseitigt. Wurde eine Person auffällig und geriet in den Fokus der Fürsorge, so gehörte es zu den Aufgaben der Fürsorgerin, Ermittlungen über den Lebenswandel und sozialen Werdegang dieser Person anzustellen und die Informationen in einer Akte zu sammeln. Außerdem lag es in der Verantwortung der Fürsorgerin, weitere Maßnahmen, wie die Unterbringung in einer Anstalt oder einem Jugendschutzlager oder die Sterilisation einzuleiten. Obligatorisch mußten sich alle auffällig gewordenen Mädchen und Frauen einer entwürdigenden gynäkologischen Untersuchung auf Geschlechtskrankheiten unterziehen. Der persönliche Eindruck sowie die Einschätzung der Fürsorgerin war entscheidend für die Beurteilung. Äußerlichkeiten wie Kleidung und Haartracht spielten bei der Beurteilung eine wesentliche Rolle. Fehlende Beweise wurden ebenso in den Akten vermerkt, wodurch sie einen hinweisenden Charakter bekamen, wie z.B. „Ein Fall von Geschlechtskrankheit konnte ihr bisher jedoch nicht nachgewiesen werden.“(11). Mit dem Wort „bisher“ wurde ein Warnsignal ausgesprochen, dass bei dieser Frau eine Geschlechtskrankheit zukünftig zu erwarten wäre. Die Formel „konnte ihr noch nicht nachgewiesen werden“ drückte aus, dass es der besonders geschickten Täterin gelungen war, eine eigentlich vorhandene Geschlechtskrankheit zu verstecken. Die Nicht-Nachweisbarkeit belegte also nicht die Unschuld, sondern wurde als ein weiteres Indiz für die Rafinesse der verdächtigten Frau gewertet(12). Vor allem galt in der Praxis der Diagnostik, dass negative Befunde zwar als belastend, Mangel an negativen Befunden oder positive Befunde aber nicht als entlastend gewertet wurden. Die Sichtweise der Betroffenen hatte wenig oder gar keinen Einfluß auf die Beurteilung.(13) Die Jugendfürsorge wurde ebenso nach rassenhygienischen Gesichtspunkten unterteilt in die Jugendpflege für die „erbgesunde“ Jugend und die Jugendfürsorge für die „minderwertige“ Jugend. Die Fürsorgeerziehungsanstalten wurden zu einem „erbbiologischen Sieb“, die die Zöglinge nach erb- und rassenhygienischen Gesichtspunkten einteilte und damit über deren weiteres Schicksal entschied. Der Misserfolg von Erziehungsbemühungen lag den rassenhygienischen Interpretationen zufolge nicht an den Mängeln der Fürsorgeerziehung, sondern an den Zöglingen(14). Nicht-Erziehungsfähigkeit wurde mit der biologischen Minderwertigkeit erklärt. Wurden die Jugendlichen als unerziehbar eingestuft, meldete die Fürsorgerziehungsbehörde die Betreffenden der Kriminalpolizei als „asoziale“ Person. Die zuständige Kripostelle stellte dann beim Reichskriminalpolizeiamt in Berlin einen Antrag auf Überstellung in ein Jugendschutzlager. So z.B. bei Irmgard: Die 19-jährige Irmgard wurde am 14.April 1944 von der Kriminalpolizei wegen ihres asozialen Verhaltens verhaftet. Mit der Begründung, dass bei Irmgard jegliche Erziehungsmaßnahmen keinen Erfolg gehabt hätten und dass auch zukünftig mit keiner Besserung zu rechnen sei, stellte die Fürsorgeerziehungsbehörde den Antrag, sie in das Jugendschutzlager Uckermark zu überstellen: „Die Mj. hatte schon als Schülerin in ihrem sittlichen Verhalten Anlass zu Klagen gegeben und späterhin zeigte sie keine Lust zur Arbeit und trieb sich herum. [...] Unter Bezugnahme auf meine beigefügten Akten bitte ich nunmehr die Einweisung dieses haltlosen Mädchens in ein Jugendschutzlager vorzunehmen, da nur die schärfsten Maßnahmen in diesem Fall von Erfolg sein dürfen.“(15) Auch bei der 20jährigen Margot lautete die Prognose, dass künftig kein Wohlverhalten zu erwarten wäre: „Ich habe Ihre Tochter eingewiesen, weil sie trotz aller bisherigen Versuche, sie an ein ordentliches Leben zu gewöhnen, immer wieder versagt und sich auch während ihrer Strafverbüßung faul und aufsässig gezeigt hat. Als letzter Versuch, sie in die Volksgemeinschaft einzugliedern, bedarf sie daher einer straffen Lagererziehung. Die Dauer ihrer Unterbringung wird von ihrer Fügung und ihrer weiteren Entwicklung dort abhängen. Sie muß erst einmal zeigen, dass sie sich einfügen kann und den ernsten Willen hat, zu arbeiten und ehrlich zu sein.“(16) In den Begründungen vermischen sich rassenhygienische Argumentationen mit Verstößen gegen die bürgerlichen Normen. Sich den bürgerlichen Tugenden wie z.B. Arbeitsethos, Ordnung und Gehorsam gegenüber der Obrigkeit zu widersetzen war gleichbedeutend damit, den Aufbau der Volksgemeinschaft zu korrumpieren. Der fürsorgerischen Fachwelt musste es jedoch klar sein, dass unter dem Deckmantel der Erziehung die „rücksichtslose“ Anwendung der „durchgreifendsten Erziehungsmittel“ sowohl in der Fürsorgeerziehung als auch im Jugendschutzlager für die Betreffenden brutale und auch lebensbedrohliche physische Gewalt einschloss. Am 14. Juli 1933 wurde das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses beschlossen, das 1934 in Kraft trat. Auf der Grundlage dieses Gesetzes sind zwischen 1934 und 1945 ungefähr 400.000 Menschen zwangssterilisiert worden(17). Das Gesetz wurde bald auch ohne formale Änderung auf weitere Personengruppen zur Verhütung der „Fortpflanzung erbkranker, asozialer, minderwertiger Elemente“ ausgedehnt(18). Die Sterilisationsdiagnostik traf besonders Frauen aus den Unterschichten, da sich die rassistische Bevölkerungspolitik vor allem auf die Verhinderung von Geburten bei den als minderwertig eingestuften Bevölkerungsgruppen konzentrierte. Der soziale Werdegang konnte zum ausschlaggebenden Indikator für ein Sterilisationsurteil sein(19). In der Praxis wurden Sterilisierungen von „Asozialen“ und „Psychopathen“ mit der Diagnose „angeborenem Schwachsinn“ vollzogen, die als Umschreibung für sozial nicht einfügbare Personen oder abweichendes Verhalten galt(20). Nur in Ausnahmefällen konnte das Urteil der Zwangssterilisation verhindert werden und hatten Protest und Widerstand von Betroffenen Erfolg(21). Nicht selten wurden die Betroffenen, insbesondere wenn es sich um weibliche Fürsorgezöglinge handelte, weder von der bevorstehenden Sterilisation noch von den Konsequenzen unterrichtet. Und ebenso wenig bot ein Urteil zugunsten der Betroffenen und gegen die Sterilisation einen wirksamen Schutz, dass die Betroffene nicht dennoch sterilisiert wurde. Mit der Zwangssterilisation ging auch häufig die Entmündigung der Betroffenen einher. Die Entmündigung erlaubte den Behörden die völlige Verfügungsgewalt über das weitere Verfahren und die Unterbringung und ermöglichte in der Praxis die Bewahrung im Vorgriff auf ein Gesetz(22). In Hamburg wurde es mit der Einrichtung von sog. Sammelpflegschaften noch effizienter, Sterilisierungsverfahren durchzuziehen. Hier tat sich vor allem Käthe Petersen mit besonderer Härte hervor, unter deren Obhut nach ihren eigenen Angaben 85 % ihrer Schützlinge sterilisiert wurden, vermutlich auch noch mehr. Die Bewahrung wurde als eine Maßnahme in Ergänzung zur Zwangssterilisation und Entmündigung gesehen. Schon seit den 20er Jahren war aus den Fachkreisen der Wohlfahrts- und Fürsorgeeinrichtungen wiederholt ein sogenanntes „Bewahrungsgesetz“ gefordert worden. Unter Bewahrung wurde der Freiheitsentzug bis auf einen unbestimmten Zeitpunkt verstanden, bis die oder der Betreffende die Gewähr bieten könne, ein an den Normen der Gesellschaft gemessenes ordentliches Leben zu führen(23). Unter Umständen konnte es sich auch um eine lebenslange Maßnahme handeln. Die Bewahrung sollte es ermöglichen, Kosten und Aufwand zu sparen und zugleich aber auch den Zugriff auf bestimmte Bevölkerungsgruppen zu erhalten. Die Bemühungen, ein Bewahrungsgesetz zu verabschieden, scheiterten jedoch an den Divergenzen, wie der Tatbestand „Verwahrlosung“ zu definieren und wie der Kreis der Bewahrungsbedürftigen einzuschränken sei. Grundsätzlich handelte es sich um dieselben Bevölkerungsgruppen, die auch unter den Sammelbegriff „Asozial“ fielen. Mit dem Vorbeugehafterlass von 1937 war jedoch ein „Bewahrungsgesetz“ der Fürsorge und auch später ein „Gemeinschaftsfremdengesetz“ nicht notwendig, da der Zugriff auf „Asoziale“ und ihre Inhaftierung in Konzentrationslagern möglich war. Zudem wurde die Bewahrung in vielen Anstalten mittels der Entmündigung praktiziert. 6. Nachkriegszeit Die unmittelbaren Monate und Jahre nach Kriegsende waren vor allem geprägt durch die große materielle Not. Die Sorge um das Ansteigen der Jugendverwahrlosung und Jugendkriminalität, um die „Verwilderung der Sitten“ und vor allem um die heimatlose und vagabundierende Jugend bestimmte den Diskurs der Nachkriegszeit. Während in Bezug auf die Wohlfahrt in der sowjetischen Besatzungszone ein größerer Bruch mit dem alten System stattfand, wurde in den westlichen Besatzungszonen recht schnell vor allem an alte Weimarer Traditionen angeknüpft.(24) Die westlichen Besatzungsmächte hatten ein großes Interesse daran, möglichst schnell wieder Ordnung herzustellen, infolgedessen wurde auf alte und bereits bestehende Strukturen zurückgegriffen. Während die nationalsozialistischen Organisationen sofort aufgelöst wurden, wurde z.B. die Wohlfahrt und Fürsorge vielerorts nach der alten Struktur wieder aufgebaut. Eine konsequente Entnazifizierung fand nicht statt. So konnte eine Hamburger Fürsorgerin berichten: „Durch die umwälzenden Ereignisse des Monats Mai 1945 erfuhr die Arbeit der Familienfürsorge keine wesentliche Unterbrechung.“(25) Wie in Hamburg wurde auch in anderen westdeutschen Städten eine Personalpolitik verfolgt, die die von den Nazis verfolgten und aus dem Amt gejagten SozialdemokratInnen wieder einsetzte und somit den Wiederaufbau nach traditionellem Muster gewährleistete. Insofern muss es nicht verwundern, dass weder über die Beurteilung von derivaten Jugendlichen noch über die nationalsozialistische Vergangenheit und Praktiken der Jugendfürsorge ein Bedarf an kritischer Auseinandersetzung bestand. Im Gegenteil griff der Diskurs der Nachkriegszeit über die Jugendverwahrlosung und die sittliche Verwahrlosung der weiblichen Jugendlichen die gleichen Muster auf und die gleichen strategischen Maßnahmen zur Herstellung der Ordnung landeten wieder auf dem Tisch. Unter dem Titel „Zeitgemäße Aufgaben und Probleme der Jugendfürsorge“ veröffentlichten 1947 zwei Marburger Wissenschaftler, Werner Villinger und Herrmann Stutte, eine Abhandlung zur Jugendverwahrlosung, die als einer der meistbesprochensten Aufsätze jener Jahre gelten sollte und maßgebend in der Bekämpfung der Jugendverwahrlosung bis in die 60er Jahre galt.(26) In diesem Beitrag beschrieben sie die Ursachen der Jugendverwahrlosung als ein „übernationales, überzeitliches, sozial-biologisches Phänomen“(27). Vokabular und Inhalte der Abhandlung sind von einer frappierenden Analogie zur nationalsozialistischen Praxis gekennzeichnet. So war die Rede von „jugendlichen sozialen Störenfrieden“ und „Gesellschaftsfeinden“ bei denen „anlagemäßige Charakterabartigkeiten und Psychopathien“ vorlägen. Ihre Vorschläge zur Behandlung waren demzufolge die Schaffung eines Arbeitsdienstes zur Verhütung von Schwererziehbarkeit, Verwahrlosung und Jugendkriminalität. Ebenso forderten sie zentrale Aufnahmeheime für die „Sichtung, Siebung und Lenkung dieses Strandgutes von jugendlich Verwahrlosten und Dissozialen“(28). Anknüpfend an ihre Forschungsarbeiten aus den 20er Jahren und aus der NS-Zeit formulierten sie in ungebrochener Tradition eine Ausrichtung der Jugendpsychatrie unter dem erbbiologisch-eugenischem Paradigma. Sowohl Villinger als auch Stutte waren im Nationalsozialismus vehemente Befürworter einer radikalen Sterilisationspraxis gewesen; Villinger z.B. , 1935 als Chefarzt der Bodelschwinghschen Anstalten tätig, weitete die fragwürdigenden geltenden Normen bei der Begutachtung zur Sterilisation in weitem Maße zuungunsten der Zöglinge aus. Das Engagement in der nationalsozialistischen Politik der Auslese und Ausmerze hat weder Villinger noch Stutte in ihrer Nachkriegskarriere behindert. Im Gegenteil: Die beiden galten als die führenden Nachkriegspersönlicheiten der Kinder- und Jugendpsychatrie in Deutschland. Über Villinger hieß es in einem Nachruf, dass die Jugendpsychatrie mit ihm „einen besonders geprägten Vertreter seines Faches, einen vorbildlichen Lehrer der Jugend“ verloren habe. Und weiter: „Er wird uns ein bleibendes Vorbild sein: Mahnung und Verpflichtung zu wissenschaftlicher Ehrlichkeit und zu einem von gütiger Menschlichkeit getragenen Arzttum“.(29) Während bei der Jugendkriminalität und Vagabondage die männliche Jugend im Blickfeld stand, wurde bei weiblichen Jugendlichen vor allem die sittliche Verwahrlosung diagnostiziert. Mädchen und Frauen, die geschlechtskrank waren, gerieten sofort in den Verdacht der Prostitution bzw. der sogenannten „heimlichen Prostitution“. Die Frauen und Mädchen, so die Unterstellung, würden nur aus materiellen Gründen ein Verhältnis mit Besatzungssoldaten eingehen und damit zu den „gefährlichsten Verbreitern“ der Geschlechtskrankheiten gehören.(30) Das enge Miteinander in den überfüllten Wohnungen, das Aufhalten in der Nähe von Unterkünften der Besatzungstruppen aber auch schon der Aufenthalt im Arbeitsamt selbst wurde als sittlicher Gefahrenherd für die weiblichen Jugendlichen gesehen. Geschlechtskrankheiten wurden als Symptom weiblicher Verwahrlosung gedeutet. Die „Fräuleins“, „Schokoladenmädchen“ oder „Veronika Dankeschön“, die Abkürzung V.D. Veneral Diseases bedeutete Geschlechtskrankheiten, waren in der Presse ein sehr beliebtes Thema. So berichtete im August 1946 die Hamburger Volkszeitung unter dem Titel „Jagd auf Frauen“ über willkürliche Razzien der Militärpolizei auf Mädchen und junge Frauen.(31) Allein auf Grund ihres Geschlechts, ihres Aussehens und ihres Verhaltens wurden Frauen der Prostitution verdächtigt. Bei der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten zogen die deutschen Behörden und Besatzungsmächte an einem Strang. Doch trotz rigidester Kontrollen war die Erfolgsquote der Behörden bei der Erfassung der infizierten Frauen nur gering - d.h. zwar wurde fast jede Frau der Prostitution verdächtigt, aber offensichtlich waren nicht die Geschlechtskrankheiten allein der Auslöser für die Besorgnis. Während für die Besatzungsmächte neben dem Schutz ihrer Truppen auch die Sorge um die britischen Frauen daheim ein Anliegen gewesen sein dürfte, sahen die deutschen Behörden und Fürsorgerinnen vor allem die Moral bedroht: hier ging es auch um die nationale Identität.(32) Diese wurde definiert über männliche Ehre und damit über weibliches Moralverhalten, das heisst die weibliche Sexualität. Deutsche Frauen, die mit den Besatzungssoldaten ausgingen, wurden angeklagt, ihre Männer und schlimmer noch , das deutsche Volk verraten zu haben – und das in Deutschlands schlimmster Stunde. Während ihre Ehemänner, Söhne, Väter an der Front starben oder in Kriegsgefangenschaft gerieten, schliefen deutsche Frauen mit dem Feind. Hinzu kam, dass nach Meinung der Fürsorgerinnen das allgemeine Verhalten deutscher Frauen in der Nachkriegszeit häufig einem traditionellen Geschlechterverständnis zuwiderlief. Und dies zu einer Zeit, als die alten Beziehungen zwischen Männern und Frauen von der Niederlage, von der Besatzung, der Fraternisierung und der Krise der Männlichkeit unterminiert wurde.(33) Bei steigenden Scheidungsziffern, zunehmender Promiskuität und anderen Formen unmoralischen Verhaltens sank gleichzeitig die als Ideal wahrgenommene Erscheinungsform der Familie, die von dem Ehemann als Versorger geführt und der Frau als dienender Hausfrau und Mutter zusammengehalten wurde. In der unmittelbaren Nachkriegszeit wie auch in der frühen Bundesrepublik durfte sich weibliche Sexualität nur in der Ehe abspielen. Wurde bei den sogenannten gefährdeten Mädchen und Frauen eine Geschlechtskrankheit diagnostiziert, mussten sie mit rigiden Sanktionen rechnen: Minderjährige mit Fürsorgerziehung, volljährige Frauen mit Anstaltsunterbringung, Entmündigung und Arbeitshaus. 7. Die Ausgrenzung von „Asozialen“ in der Nachkriegszeit Unter der Federführung des Hamburger Landesjugendamtes wurden bereits ab 1946 Entwürfe für ein gemeinsames Arbeitserziehungsgesetz für die britische und amerikanische Zone diskutiert. Mit diesem Gesetz sollte vor allem eine Handhabe gegen die vagabundierenden Jugendlichen geschaffen werden, für die die Fürsorgeerziehung als nicht ausreichend erschien. Gleichzeitig wurde an einer „Verordnung zur Unterbringung verwahrloster Frauen und Mädchen“ gefeilt, nach der Frauen und Mädchen über 18 Jahre, „die durch ihren Lebenswandel zur Verbreitung von Geschlechtskrankheiten beitragen können und damit eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit bedeuten oder die sonst verwahrlost sind“ auf Antrag des Fürsorge- oder Gesundheitsamtes in Arbeitserziehung gebracht werden können.(34) Während zunächst breitere Kreise der Fürsorge diese Vorstöße begrüßten, so gab es dennoch auf der politischen Ebene Protest gegen die Arbeitserziehung, die nicht zu Unrecht als KZ-Methoden kritisiert wurde. Im Lauf einer mehrjährigen Diskussion wurde als Kompromiss 1950 ein Gesetz verabschiedet, das Arbeitsprogramme für Jugendliche auf freiwilliger Basis vorsah. Die sogenannte Arbeitserziehung aber hatte in Hamburg bereits Tradition: Während des Nationalsozialismus hatte Hamburg ein sog. Arbeitserziehungslager für sog. „Arbeitsbummelanten“ in Munster, was nichts anderes als ein Konzentrationslager war.(35) Unmittelbar nach Kriegsende wurde wieder in den Fürsorgekreisen die Forderung nach einem „Bewahrungsgesetz“ laut. Personelle Kontinuitäten gewährleisteten, dass bereits im Herbst 1946 ein Vorschlag vorgestellt werden konnte. Dabei schienen die 12 Jahre Nazi-Herrschaft offensichtlich für die Beteiligten an der Ausgestaltung eines neuen Bewahrungsgesetzs keine Rolle zu spielen; jeder Zusammenhang eines Bewahrungsgedankens mit der nationalsozialistischen Fürsorge wurde ausgeblendet und dagegen scheinbar bruchlos an die traditionellen Leitbilder der Weimarer Zeit angeknüpft.(36) Helene Wessel, seit den 30er Jahren die wichtigste und führende Bewahrungstheoretikerin, brachte 1951 einen entsprechenden Entwurf in den Bundestag ein: „... Auf allen Arbeitsgebieten der Fürsorge findet man Gefährdete und Verwahrloste, die geistig und seelisch anormal sind und deshalb für ihr Handeln nicht voll verantwortlich gemacht werden können. Es sind jene Menschen, die mit dem Leben nicht zurechtkommen, die unfähig sind, sich in die Gesellschaft einzuordnen [...] Gewiß meine Damen und Herren, bringt ein Bewahrungsgesetz Eingriffe in die persönliche Freiheit des Bewahrungsbedürftigen, aber es handelt sich doch hier um Menschen, die ihre Freiheit zum eigenen Schaden und zum Schaden des Gemeinwohls missbrauchen oder sie nicht richtig gebrauchen können.“(37) Zu der Verabschiedung eines Bewahrungsgesetzes kam es nicht. Allerdings fand der Bewahrungsgedanke unter der Formel „Hilfe für Gefährdete“ 1961 Eingang in das Bundessozialhilfegesetz. In der fürsorgerischen Praxis wurde jedoch die Bewahrung ganz offen gehandhabt und in nicht wenigen Anstalten gab es ganz offiziell sogenannte „Bewahrabteilungen“. Obgleich sich in den Akten und Publikationen der Nachkriegszeit nicht selten die Bezeichnung Asozial wiederfindet, setzte sich zunehmend der alte Begriff der „Gefährdeten“ durch. Nach dem Bundessozialhilfegesetz von 1961 lautete die Definition für Gefährdete: „Personen, die das 20. Lebensjahr vollendet haben und dadurch gefährdet sind, dass sie aus Mangel an innerer Festigkeit ein geordnetes Leben in der Gemeinschaft nicht führen können, soll Hilfe gewährt werden.“(38) Personen, die sozusagen eine Gefahr für die Ordnung darstellten wurden zu „Gefährdeten“. Die Bezeichnung Gefährdete war bewusst allgemein gehalten, um den Zugriff auf unterschiedliche Personenkreise sozial nicht angepasster Gruppen zu erhalten, im wesentlichen handelte es sich um den Personenkreis, „...welcher früher unter dem disqualifizierenden Begriff der „Asozialen“ zusammengefasst wurde“(39). Eine ausführliche Anleitung zur praktischen Auslegung der rechtlichen Bestimmungen für Gefährdete lieferte Käthe Petersen(40). Maßstab für die Beurteilung von Anpassung und Lebenstüchtigkeit der Betroffenen war der Wille zur Arbeit. Häufiger Stellenwechsel oder Renitenz gegen die Obrigkeit galten - wie auch im Nationalsozialismus - als Kennzeichen für arbeitsscheu und waren ein Symptom für Verwahrlosung. Kam die FürsorgerIn zu der Einschätzung, dass die Betroffene sich der Ordnung widersetzte, standen härtere Maßnahmen zur Verfügung wie z.B. der Freiheitsentzug. Erst 1974 wurden diese Paragraphen aus dem Bundessozialhilfegesetz gestrichen. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses wurde in der Bundesrepublik von den Alliierten nie aufgehoben, weil es nicht als typisches NS-Unrechtsgesetz angesehen wurde.(41) Zwar war es faktisch außer Vollzug, da es keine Erbgesundheitsgerichte mehr gab, die Sterilisationen anordneten. 1947 gab es einen neuen Vorstoß, ein Sterilisationsgesetz zu erarbeiten. Beauftragt war damit Dr. Villinger. Zwar wurde das Gesetz nicht verabschiedet, Villinger wurde jedoch 1961 als Gutachter im Wiedergutmachungsausschuß im Deutschen Bundestag angehört, wo er sich gegen die Entschädigung von Sterilisierungsopfern aussprach. In der sowjetischen Besatzungszone hob die sowjetische Militäradministration 1946 das Gesetz auf und erklärte es als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dieser Befehl wurde aber auch in der DDR geheim gehalten und nur treuen SED-Genossen zugänglich gemacht, damit diese nach den Richtlinien für die Anerkennung als Verfolgte des Naziregimes vom 10. Februar 1950 anerkannt werden konnten.(42) In der Bundesrepublik wurde dem GzVeN jedoch sogar Rechtstaatlichkeit zugebilligt: 1967 kam eine Kommission, die sich mit der Frage auseinandersetzen sollte, ob zur Zeit des Nationalsozialismus Personen zu Unrecht unfruchtbar gemacht wurden, zu dem Schluß, dass in 75% der Sterilisationsverfahren das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses rechtlich richtig angewandt worden war, nur in 25 % der Fälle sei das Verfahren nicht rechtlich korrekt ausgeführt worden. Erst 1988 hat der Bundestag das GzVeN geächtet und den Opfern und ihren Angehörigen Achtung und Mitgefühl bezeugt. Zu erwähnen sei hier auch noch, dass bis in die 80er Jahre hinein sog. geistig behinderte Mädchen und Frauen in der Bundesrepublik sterilisiert worden sind. 8. „Asoziale“ in der DDR In der DDR konnte die fortbestehende Asozialität unter den Bedingungen des Sozialismus nur systemäußerlich erklärt werden: als Reste der überwundenen kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse oder als Vergiftung durch den westlichen Klassenfeind(43): „[...] die gesellschaftliche und ökonomische Entwicklung in unserem Arbeiter- und Bauernstaat und die damit verbundene Herausbildung einer neuen sozialistischen Moral und Ethik [ließ] auch solche Erscheinungen des Kapitalismus, wie Prostitution, Landstreicherei, Bettelei usw. fast völlig verschwinden [...]“(44). Demzufolge wurde Asozialität als persönliches Verschulden der/des einzelnen definiert. Als „Gefährdete“, auch in der DDR wurde die Bezeichnung „Asoziale“ durch „Gefährdete“ ersetzt, zählten die gleichen Personenkreise wie zuvor: Landstreicher, Bettler, Prostituierte, Alkoholabhängige, sozial unangepasste Menschen, denen „Arbeitsscheu“ und „Verwahrlosung“ zugeschrieben wurde. Oberstes Kriterium für Wohlverhalten und Einordnung in die sozialistische Gesellschaft war die Arbeit. Sich der Pflicht zur Arbeit zu widersetzen oder zu entziehen, wurde in erster Linie mit strafrechtlichen Mitteln und Härte begegnet: „Aber auch auf die Arbeitskraft der gefährdeten wollen wir nicht verzichten. Wir brauchen jede Hand zum Aufbau.“(45) Über die Teilnahme an der Produktion sollten auch die Asozialen gesellschaftliche Miteigentümer werden. „Arbeitsscheue“ wurden seit Anfang der 60er Jahre zunehmend kriminalisiert. Bis in die 60er Jahre hinein existierten in der DDR Arbeitshäuser: 1958 bestanden noch 31 Arbeitshäuser mit über 2000 Plätzen(46), die allerdings vornehmlich für strafrechtlich eingewiesene sexuell gefährdete Frauen genutzt wurden. Die Verfolgung „sittlich Gefährdeter“ verlief nach dem gleichen Schema wie zuvor, nur dass die Begründungen um den Schutz der Werktätigen und des Sozialismus ergänzt wurden: „Die Angeklagte gefährdete durch ihr leichtfertiges Verhalten ihre eigene Gesundheit und die Gesundheit anderer. [...] In einem solchen Verhalten liegt eine Mißachtung der sittlichen und moralischen Anschauungen unserer Werktätigen.“(47) Geschlechtskrankheiten wurden in der sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR von 1945 besonders streng verfolgt und geahndet.(48) Wurde eine Geschlechtskrankheit festgestellt, so musste die Betroffene mit Freiheitsstrafe und anschließender Unterbringung im Arbeitshaus rechnen. Die Arbeitshäuser hießen offiziell „Heime für soziale Betreuung“, die angeblich mit den früheren Arbeitshäusern nicht zu vergleichen seien. Dagegen hätten sie ihren militärischen Zwangscharakter abgelegt und ihr Zweck sei eine „Umerziehung“ zur Einfügung ins Kollektiv mit „geduldiger und beharrlicher Überzeugungsarbeit“ sowie „regelmäßiger Arbeit“.(49) Kurz nach dem Mauerbau 1961 wurde es mit der Verordnung über Aufenthaltsbeschränkung möglich, bei sog. arbeitsscheuen Personen den Freiheitsentzug anzuordnen was gleichbedeutend mit Arbeitserziehung war. So hieß es in einem Bericht Ullbrichts an Chruschtschow: „Es gibt Jugendliche, die durch die westliche imperialistische Propaganda und Asphaltkultur stark verseucht sind. Ein Teil junger Werktätiger weigert sich zu arbeiten und trieb sich auf den Straßen herum. Wir haben einen Teil von ihnen von der Straße weg ins Arbeitslager transportieren lassen, zum Zweck der Arbeitserziehung.“(50) Zur sogenannten Arbeitserziehung Minderjähriger standen die sog. Jugendwerkhöfe zur Verfügung, die mit rigidesten Maßnahmen und militärischem Drill Gefängnissen glichen und deren Ziel die Willensbrechung war.(51) Die Bezeichnung arbeitsscheu war im Gebrauch aber auch ein Synonym für politische Unzuverlässigkeit. Der Kampf gegen die „Asozialen“ wurde damit auch zu einem Kampf um die Sicherung der Staatsmacht hochgespielt. 1968 wurde der [[section]] 249 in das neue Strafgesetzbuch der DDR aufgenommen, damit wurde Asozialität ein Strafdelikt, Asozialität als Quelle von Kriminalität beschrieben und „Nichtarbeit“ als „permanente Entwendung von Volkseigentum“ kriminalisiert(52). Mit der Verordnung über die Aufgaben der örtlichen Räte und der Betriebe bei der Erziehung kriminell gefährdeter Bürger wurde seit Ende der 60er Jahre die Ausgrenzung von Asozialen zunehmend vergesellschaftet: Räte und Betriebe waren angewiesen, sog. gefährdete BürgerInnen zu kontrollieren, ihnen dem Umgang mit bestimmten Personen oder den Besuch von Lokalitäten zu untersagen und ihnen Arbeit und Wohnung zuzuweisen(53). Einhergehend mit der Sicherung der elementaren Grundbedürfnisse seitens des Staates, sorgte damit ein engmaschiges Netz von Überwachungsmaßnahmen und sozialer Kontrolle für die Einfügung in die Produktion sowie unter die erwarteten Verhaltensregeln. Sowohl der [[section]] 249 als auch die Verordnung wurden bis 1989 mehrfach überarbeitet. Erwähnt werden soll hier noch die Fassung von 1979, die mit dem Absatz „Beeinträchtigung“ der öffentlichen Ordnung und Sicherheit eine Ausdehnung des Begriffs „Asozial“ ins Unbestimmte erlaubte. Das grundlegende Problem der strafrechtlichen Antwort auf „Asozialität“ in der DDR war, dass notwendige sozialpolitische Hilfen wie z.B. bei Alkoholabhängigen mit dem strafrechtlichen Analyserahmen und dem zur Verfügung stehenden Sanktionsinstrumentarium nicht wirklich begegnet werden konnte. Kritische Untersuchungen zu dieser Problematik im Umgang mit Formen von Asozialität wie Alkoholabhängigkeit gab es sehr wohl, diese wurden aber unter Verschluß gehalten, da es qua Ideologie offiziell in der DDR keine sozialen Probleme gab und folglich auch keine entsprechenden Alternativlösungen. Handelte es sich um politische AbweichlerInnen, war die Problemlage natürlich anders. Ihnen wurde das Leben als Asoziale erschwert. War eine Person jedoch einmal als „asozial“ in den Fokus der Behörden geraten, so hatten die Betroffenen nur wenige Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben: Das engmaschige Netz sozialer Kontrolle funktionierte in allen Lebensbereichen.(54) 9. Anerkennung als Verfolgte des Nationalsozialismus und Entschädigung Trude N. kam als 14jährige während des Nationalsozialismus in Fürsorgeerziehung, weil sie von ihrem Onkel sexuell missbraucht worden war. Als junge Frau hatte sie ein Verhältnis mit einem Wehrmachtsoldaten und bekam ein uneheliches Kind von ihm. Als sie das Kind wegen einer Krankheit ins Krankenhaus bringen musste, wurde sie auf dem Rückweg von der Kriminalpolizei verhaftet und als „Asoziale“ in ein Konzentrationslager verschleppt. Sie überlebte. Nach ihrer Befreiung und Rückkehr wurde ihr die Rechnung präsentiert: Die Kosten für den zweijährigen Heimaufenthalt ihres Kindes. Die Schulden bedeuteten jahrelange Armut und ein Fristen am Rande des Existenzminimums. Vergeblich hat sie sich immer wieder um eine Anerkennung als NS-Verfolgte und Entschädigung bemüht. Erst 1990 erlangte sie mit Hilfe des Bundesverbandes für NS-Verfolgte die Anerkennung und erhält seitdem eine Zusatzrente. Die Leidensgeschichte von Trude N. ist kennzeichnend für den bundesdeutschen Umgang mit im NS als „asozial“ Verfolgten: In der Bundesrepublik wurden sie nicht als Verfolgte des Nazi-Regimes anerkannt. Im Gegenteil: Das harte Vorgehen gegen sogenannte Asoziale wurde allgemein als positive Seite der Nazizeit gewertet, es wurde sich deutlich von den Asozialen abgegrenzt, vielfach auch unter den Verfolgten des Nationalsozialismus. Bis in die 80er Jahre hinein lautete eine Tafel in der Gedenkstätte des ehm. Konzentrationslager Dachau: „Anfangs gab es nur politische Häftlinge, Sozialdemokraten, Kommunisten, christliche und liberale Politiker. Um sie in der Öffentlichkeit als minderwertige Menschen zu diffamieren, wurden Kriminelle und sog. Asoziale ins Lager eingeliefert.“ Mit der Behauptung, die „Asozialen“ wären nur zu Diffamierung der „Politischen“ in die Konzentrationslager eingewiesen, wurde ihnen auch eine eigenständige Verfolgungsgeschichte abgesprochen. Die vielfältige Unterdrückung nicht angepasst lebender Menschen im Nationalsozialismus begriff die Nachkriegsgesellschaft nicht als nazispezifisch und rassistische Denktraditionen und Gesetzesgebungen waren auch nach 1945 zunächst „normal“: Pflichtarbeit und Arbeitszwang waren auch im bundesrepublikanischen Fürsorgerecht legitime Mittel, Einweisung in Arbeitshäuser (erst Ende der 60er Jahre abgeschafft), Entmündigungen nur langsam aufgehoben, Bettelei, Landstreicherei und Prostitution wurden bis Mitte der 70er Jahre zur Strafrechtsreform strafrechtlich verfolgt. Wie ungebrochen mit der nationalsozialistischen Ideologie auch die Jugendschutzlager, euphemistisch als Erziehungseinrichtungen bezeichnet, noch nach 1945 als notwendige und gute Einrichtungen stilisiert wurden, zeigt auch ein Zitat von der Kriminalrätin Friederike Wieking von 1958, der ehemals im Reichskriminalpolizeiamt als Leiterin der Weiblichen Kriminalpolizei die Jugendschutzlager offiziell unterstellt waren: „Man mag zu dieser Einrichtung stehen wie man will, eines verdient nachdrücklich festgehalten zu werden: wäre sie nicht entstanden [die Idee der polizeilichen Jugendschutzlager, K.L.] so wären diese schwer gefährdeten Minderjährigen, die immer wieder mit dem Strafrecht und somit auch der Polizei in Konflikt gerieten, unweigerlich – und zwar ohne Anhörung der Jugendbehörden – in die Konzentrationslager zu den erwachsenen Asozialen und Gemeinschaftsfremden gekommen.“(55) Das Bundesentschädigungsgesetz von 1953 schloss die als asozial Verfolgten von einer Entschädigung aus, da als Verfolgungsgründe „politische Überzeugung“, „Rasse“, „Glaube“ oder „Weltanschauung“ gezählt wurden. Diese Gründe schlossen aber alle diejenigen aus, die relativ willkürlich von den Nazis aufgrund ihrer sozialen Unangepasstheit verfolgt und inhaftiert wurden. Oder diejenigen, die aufgrund der nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik verfolgt wurden. Im Fall der „Asozialen“ wurde zwar zugestanden, dass die Einweisung in Konzentrationslager zwar eine rechtswidrige Maßnahme gewesen sei, die aber nach den Kriterien des BEG nicht zu einer Entschädigung berechtige. Erst in den 80er Jahren begann die Forschung sich überhaupt den als „asozial“ Verfolgten zuzuwenden. Erst in den 80er Jahren gab es Auflockerungen in der Entschädigungspraxis. Es wurden sog. Härteregelungen und Sonderfonds beim Bund und in einzelnen Bundesländern eingerichtet, nach denen es möglich ist, einmalige oder laufende Beihilfen sowie Zusatzrenten zu beantragen. Schluß Georg Steigertahl bedauerte 1950: „...das Jahrzehnte alte Zusammenspiel zwischen Anstaltsleitung, Psychatrie und Polizei, dem die Ordnung auf den Straßen und in den Kaschemmen Hamburgs zu danken gewesen war, wurde zerstört. Neuerdings bestimmen Richter die Rechtslage, das Sozialgericht beugt sich unter der Last der Arbeit. Die Asozialen und streunenden Menschen gehen angenehmen Zeiten entgegen“(56). Dies Zitat verdeutlicht die Brüche und Kontinuitäten im Umgang mit als „asozial“ stigmatisierten Menschen in der bundesrepublikanischen Gesellschaft. Die radikale Verfolgung und Ermordung von „Asozialen“ im Nationalsozialismus war nur möglich auf Grund des bereits verankerten breiten gesellschaftlichen Konsens, der über die Ausgrenzung dieser Personengruppen bestand. Rassenhygienische Erklärungen ließen sich gut mit traditionellen bürgerlichen Vorstellungen von einem wohlgeordneten Lebenswandel kombinieren und boten zudem Lösungsvorschläge zu sozialen Problematiken. Auch nach Ende des nationalsozialistischen Regimes beherrschten diese rassistischen Muster das Denken. Da die nationalsozialistischen Lösungsmuster jetzt jedoch nicht mehr möglich waren, wurde auf die alten Weimarer Traditionen und Strukturen zurückgegriffen, die durch das eugenische Gedankengut und bürgerliche Werte geprägt waren. Zumindest in der unmittelbaren Nachkriegszeit konnten sich diese Kräfte noch durchsetzen. Der Umgang mit den als „asozial“ Verfolgten des Nationalsozialismus zeigt jedoch, wie wirkungsmächtig auch heute noch rassistische und stereotype Ausgrenzungsmechanismen in der bundesrepublikanischen Gesellschaft sind. Neben der finanziellen Entschädigung steht die Antwort, wie ein würdiges Gedenken an die Opfer der als „asozial“ Verfolgten aussehen kann, immer noch aus. Katja Limbächer Fußnoten: (1) Das Versorgungshaus- und Arbeitshaus Farmsen war eine sog. Mischanstalt für Arme und Alte, Pflegebedürftige, Irre und Krüppel. Später kamen Arbeitshäusler, Strafentlassene, Bettler, Obdachlose und Prostituierte und eine Station für gefährdete Frauen und Mädchen dazu. Im Nationalsozialismus waren mit Zustimmung der Fürsorge außerdem dort sog. kriminelle Sicherungsverwahrte, Kriegsgefangene und ZwangsarbeiterInnen interniert, vgl. „Was hat Hamburg nur mit Euch Frauen gemacht?“ Staatliche Fürsorge und ihre Folgen von der Weimarer Republik bis in die Gegenwart, Arbeitsbuch zum Film, Hamburg 1992 (2) Georg Steigertahl: Zwischen Epochen der Weltgeschichte. Dienstliche Erlebnisse von 1926 – 1950 des Direktors der hamburgischen Wohlfahrtsanstalten Hamburg, S.58 (3) vgl. Claudia Brunner: <<Fürsorgeausnützer wurden ausgemerzt>> Die Sozialpolitik des Münchner Wohlfahrtsamtes am Ende der Weimarer Republik und in der frühen NS-Zeit, in: Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus (Hg.): Durchschnittstäter, Bd. 16, Berlin 2000, S. 53-72, S.53ff (4) vgl. Jürgen Reyer: Alte Eugenik und Wohlfahrtspflege, Freiburg im Breisgau 1991 (5) vgl. Wolfgang Ayaß: „Asoziale“ im Nationalsozialismus, Stuttgart 1995 (6) Wolfgang Ayaß: <<Gemeinschaftsfremde“, Quellen zur Verfolgung von „Asozialen“ 1933-1945, Materialien aus dem Bundesarchiv H.5, Koblenz 1998 (7) vgl. Christa Schikorra: Kontinuitäten der Ausgrenzung. „Asoiziale“ Häftlinge im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück (8) vgl. Wolfgang Ayaß 1998, XII (9) vgl. Ayaß 1998, XII (10) vgl. Carola Kuhlmann: Erbkrank oder erziehbar? Jugendhilfe als Vorsorge und Aussonderung in der Fürsorgeerziehung in Westfalen, Weinheim und München 1989, S.192 (11) vgl. Patrick Wagner: Volksgemeinschaft ohne Verbrecher. Konzeptionen und Praxis der Kriminalpolizei in der Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus, Hamburg 1996, S.372 (12) vgl. Patrick Wagner, 1996, S.372 (13) Katja Limbächer; Maike Merten: Die Einweisungspraxis der Kriminalpolizei in das Jugendschutzlager Uckermark, in: Katja Limbächer, Maike Merten; Bettina Pfefferle (Hg.): Das Mädchenkonzentrationslager Uckermark, Münster 2000, S.95-109 (14) vgl. Detlef J.K. Peukert; Richard K. Münchmeier: Historische Entwicklungsstrukturen und Grundprobleme der deutschen Jugendhilfe, in: Sachverständigenkommission 8. Jugendbericht (Hg.), München 1990, S.26f (15) zit. Katja Limbächer; Maike Merten, 2000, S.95 (16) zit. in Katja Limbächer; Maike Merten, 2000, S.101 (17) vgl. Andrea Brücks: Zwangssterilisation gegen ‚Ballastexistenzen’ in: Projektgruppe 1986, 103 (18) vgl. Burgdörfer 1934, zit. in Claudia Schoppmann: Nationalsozialistische Sexualpolitik und weibliche Homosexualität, Pfaffenweiler 1991, S.69 (19) vgl. Gisela Bock: Zwangssterilisation im Nationalsozialismus, Opladen 1986, S.323 (20) vgl. Gisela Bock, 1986, 322 (21) vgl. Carola Kuhlmann 1989, S.133 (22) vgl. Wolfgang Ayaß 1995, S.97 (23) vgl. Angelika Ebbinghaus: Helene Wessel und die Verwahrung, in: dies.: Opfer und Täterinnen. Frauenbiographien des Nationalsozialismus, Frankfurt a.M. 1996, S.193 (24) vgl. Doris Foitzik: Jugend ohne Schwung? Jugendkultur und Jugendpolitik in Hamburg 1945-1949, Hamburg 2002, S.86ff (25) Evelyn Glensk: Notstandgebiet II, in: Christiane Rothmaler, Evelyn, Glensk (Hg.): Kehrseiten der Wohlfahrt. Die Hamburger Fürsorge auf ihrem Weg von der Weimarer Republik in den Nationalsozialismus, Hamburg 1992, S. 298 (26) vgl. Wolfram Schäfer: „Sichtung, Siebung und Lenkung“ Konzepte Marburger Wissenschaftler zur Bekämpfung von Jugendverwahrlosung“, in: Hafeneger, Benno; Schäfer, Wolfram (Hg.): Marburg in den Nachkriegsjahren, Marburg 1998, S. 197-251 (27) Wolfram Schäfer, 1998, S. 277 (28) Wolfram Schäfer, 1998, S. 282 (29) Wolfram Schäfer 1998, S.254 (30) Doris Foitzik, 2002, S. 98 (31) Michaela Freund: Frauen, Prostitution und die Kontrolle weiblicher Sexualität in Hamburg in der Nachkriegszeit, in: Christian Groh (Hg.): Öffentliche Ordnung in der Nachkriegszeit, Ubstadt-Weiher 2002, S.127-142 (32) vgl. Michaela Freund, 2002, S.132 (33) vgl. Michaela Freund, 2002, S.132 (34) vgl. Doris Foitzik 2002, S.109 (35) vgl. Doris Foitzik 2002, S.114 (36) vgl. Petra von der Osten: Jugend- und Gefährdetenfürsorge im Sozialstaat. Auf dem Weg zum Sozialdienst katholischer Frauen 1945-1968, Paderbron 2003, S.187ff (37) Angelika Ebbinghaus: Helene Wessel und die Verwahrung, in: Angelika Ebbinghaus, 1996, S.191ff (38) Hilfe für Gefährdete, S.4 Hilfe für Gefährdete, in: Korrespondenzblatt, Nr. 1, Januar 1963, 33. Jahrgang, S.4-5 (39) Nieten, S.43 Nieten, Herbert: Die häufigsten Erscheinungsbilder der Gefährdeten, in: Die Hilfe für Gefährdete in der Verantwortung der Gesellschaft. Bericht über die Hauptausschußtagung am 19. und 20. Juni 1964 in Hamburg, Schrift 225, Köln 1965, S.43-59 (40) Vgl. Petersen: Rechtliche Grundlagen Petersen, Käthe: Rechtliche Grundlagen einer Hilfe für Gefährdete, in: Die Hilfe für Gefährdete in der Verantwortung der Gesellschaft. Bericht über die Hauptausschußtagung am 19. und 20. Juni 1964 in Hamburg, Schrift 225, Köln 1965, S.61-96 (41) Michael Becker: Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 und Opferentschädigung in der Bundesrepublik Deutschland, unveröffentl. Diplomarbeit, Frankfurt a.M. 1996, S.29ff (42) zit. in Michael Becker, 1996, S.30 (43) Wilfried Rudloff: Öffentliche Fürsorge, in: Hans Günther Hockerts (Hg.): Drei Wege deutscher Sozialpolitik: NS-Diktatur, Bundesrepublik und DDR im Vergleich, München 1998, S. 191-229, S.202 (44) Heinz Reichert: Die Gefährdetenfürsorge in der deutschen Demokratischen Republik, in: Arbeit und Sozialfürsorge, Nr.5/1960, 15. Jahrgang, S.115-118, S.115 (45) Heinz Reichert, 1960, S.115 (46) vgl. Wilfried Rudloff, 1998, S.202 (47) Heinz Reichert, 1960, S.115 (48) vgl. Wilhelm Weiß: Das Gesundheitswesen in der sowjetischen Besatzungszone, Bonn 1952, S.37 (49) Heinz Reichert, 1960, S.116 (50) zit. in Wilfried Rudloff, 1998, S.203 (51) Vgl. Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburgs (Hg.): Einweisung nach Torgau. Texte und Dokumente zur autoritären Jugendfürsorge in der DDR, Bd. 4, Berlin 1997 (52) Matthias Zeng: „Asoziale“ in der DDR. Transformationen einer moralischen Kategorie, Münster 2000, S. 34 (53) Wilfried Rudloff, 1998, S.203 (54) vgl. Matthias Zeng, 2000, S.165ff (55) Friederike Wieking: Die Entwicklung der weiblichen Kriminalpolizei, Lübeck 1958, S.70 (56) Georg Steigertahl zit. in Christiane Rothmaler: „Hart in der Sache, milde im Ton, frei von Bürokratismus.“ Georg Steigertahl und sein Konzept der Anstaltsfürsorge, in Christiane Rothmaler; Evelyn Glensk 1992, S.182 |
|